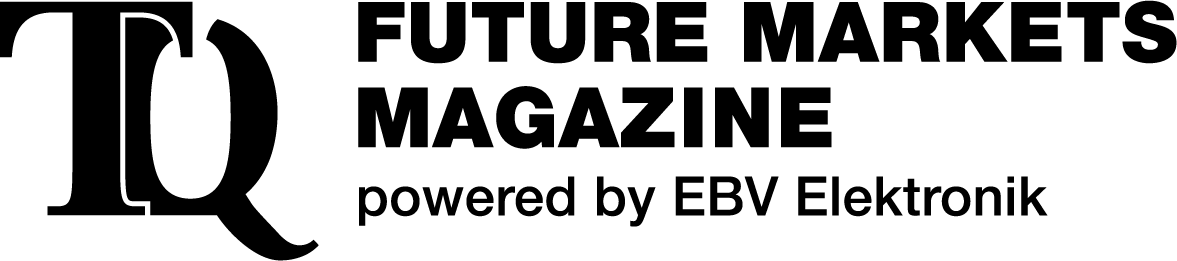Im Gespräch mit Nikolaj Hviid, CEO von Bragi, dem Erfinder des weltweit ersten Ohrcomputers
Beim Münchner Start-up Bragi herrscht Hochbetrieb – Firmenvertreter aus Asien, Mitarbeiter und Lieferanten geben sich in der Büroetage mitten in München die Klinke in die Hand. Aber Nikolaj Hviid, CEO und Gründer von Bragi, macht einen ganz gelassenen Eindruck. Immerhin sind die Entwicklungen von „The Dash“ im Wesentlichen abgeschlossen, die ersten 12.000 Geräte (Stand: Februar 2016) ausgeliefert. Hviid scheint mit seinem diskreten Assistenten für alle Lebenslagen tatsächlich einen Nerv getroffen zu haben. Erst 2014 hat Bragi das bislang finanziell erfolgreichste Kickstarter-Projekt in Europa abgeschlossen. Seitdem hat sich das junge Unternehmen von einem vielversprechenden Start-up zu einem marktbewegenden Treiber innovativer Technologie entwickelt. Für seine Vision eines im Ohr tragbaren Computers hat der Designer Hviid einiges riskiert: Überzeugt von seiner Idee, verkaufte er seine Anteile an der von ihm mitgegründeten Designagentur – übrigens die größte in Europa – und steckte sein Geld in „The Dash“. Für ihn stand allerdings gar nicht die Elektronik oder der Wille, ein Wearable zu entwickeln, im Vordergrund. Der gebürtige Däne sieht sich vielmehr als jemand, der gesellschaftliche Probleme löst. Seine Visionen hat er schon öfters mit Technik und Design realisiert – Bragi ist seine sechste Unternehmensgründung. „Ein Unternehmen zu starten ist ein Roller Coaster on Steroids“, meint Hviid – aber er scheint die Fahrt zu genießen …
Wie wird man vom Designer zum Chef eines Elektronik-Start-ups?
Nikolaj Hviid: In Deutschland sieht man Design unter einem eher künstlerischen Ansatz. In Dänemark versteht man dagegen unter Design die Lösung gesellschaftlicher oder unternehmerischer Probleme. Und genau das habe ich gemacht: Ich wollte nicht unbedingt ein Elektronikunternehmen gründen. Aber ich wollte ein gesellschaftliches Problem lösen – nämlich einen diskreten Computer entwickeln, der den Menschen unterstützen kann. Und diesen Computer konnte ich nur realisieren, wenn ich auch die Elektronik dafür entwickle. Also kam ich nicht drum herum, ein Elektronikunternehmen zu gründen.
Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee für „The Dash“?
N.H.: Die Grundidee war, einen Assistenten zu realisieren, der den Menschen hilft. Damit das aber auch funktioniert, muss die Unterstützung diskret erfolgen, also ohne den Nutzer von seiner Umgebung oder aktuellen Tätigkeit abzulenken. Ein Bildschirm zum Beispiel ist damit ausgeschlossen. Das Gehör ist aber anders – es ist ein paralleles diskretes Interface: Ich höre alles um mich herum gleichzeitig, kann alles auseinanderhalten und meiner Tätigkeit weiter nachgehen. Also war meine erste Idee, dass ich etwas über das Gehör machen muss.
Zweite Idee war, dass der Assistent auch verstehen muss, wo ich bin, was ich mache und wie ich darauf reagiere. Ansonsten kann er mir nicht helfen. Also müssen in das Gerät Sensoren integriert werden, die die Umgebung erkennen und meine Reaktion messen können. Mit diesen Informationen kann das Gerät verstehen, was ich als Person mache, und mir dabei helfen. Das nennt man einen kontextuellen Computer.
Der nächste Schritt: Da Bewegungen an einem Kabel die Sensordaten stören würden, muss es kabellos funktionieren. Also habe ich als Resultat ein Gerät, das im Ohr sitzt, viele Sensoren hat und keine Kabel benötigt – The Dash.
Welche Anwendungen hatten Sie denn konkret im Sinn?
N.H.: Gut, wenn ich im Elektrofachmarkt einfach nur einen kontextuellen Computer verkaufen wollte, wäre das nicht sehr erfolgreich. Ich muss also Anwendungen definieren, deren Nutzen der Käufer sofort versteht. Wir alle mögen es, Musik zu hören – also haben wir als eine primäre Anwendung ein Musikwiedergabegerät. Zweite primäre Anwendung ist, dass es als Headset eingesetzt werden kann. Und drittens haben wir es als Fitnessgerät positioniert. Aber der Gedanke dahinter ist immer noch ein kontextueller Computer, der mir hilft.
Was könnten Sie sich dann als „sekundäre“ Anwendungen vorstellen?
N.H.: Da gibt es unzählige Möglichkeiten: Ich könnte damit durch Kopfbewegungen einen Rollstuhl steuern, Feuerwehrleute könnten beim Einsatz überwacht werden und miteinander kommunizieren oder The Dash setzt automatisch einen Notruf ab, wenn der Träger zum Beispiel einen Schlaganfall erleidet.
Diese Applikationen wollen Sie in Ihrem Unternehmen entwickeln?
N.H.: Nein, wir verstehen uns als ein Plattformlieferant. Als einen Hersteller von Ohrcomputern oder „Audible Computing“.
Gibt es denn schon Firmen, die Apps für The Dash entwickeln wollen?
N.H.: Absolut. Eigentlich sogar schon zu viele: Wir haben fast 7.000 Entwickler, die sich angemeldet haben und gerne etwas für das Produkt entwickeln wollen.
Welche Rolle spielt die Crowdfunding-Kampagne bei der Realisierung von The Dash?
N.H.: Was ich toll finde am Crowdfunding ist, dass nicht irgendein Finanzinvestor entscheidet, ob meine Idee gut oder schlecht ist, sondern hunderttausende von Menschen. Und fast 16.000 Menschen fanden unser Projekt so überzeugend, dass sie dafür bezahlt haben.
Was glauben Sie, ist die Motivation der Funder?
N.H.: Die Menschen machen es nicht, weil sie mich toll finden oder unbedingt das Produkt haben wollen. Die meisten Menschen wollen das Projekt verfolgen. Sie wollen teilhaben an dem, was wir tun, und uns begleiten auf der Reise bis zum fertigen Produkt.
Die Crowdfunder haben mehr als 3,3 Millionen US-Dollar in Ihr Projekt investiert. Reicht das, um ein neues Unternehmen aufzubauen?
N.H.: Ganz ehrlich – Crowdfunding dient nicht in erster Linie dazu, Geld zu bekommen. Denn am Ende bleibt davon nicht viel übrig. Erst einmal muss man zehn Prozent Gebühren für Kickstarter und Amazon Payment abziehen. Dann erhalten die Crowdfunder ja das Gerät vergünstigt, so dass, wenn man die Produktionskosten abzieht, nicht mehr viel Gewinn bleibt. Darüber hinaus muss man für die benötigten Fertigungsanlagen zahlen. Bei uns kosteten alleine die Spritzgusswerkzeuge doppelt so viel wie alles, was übriggeblieben ist. Dann kommt noch die Zertifizierung, denn wir wollen ja in die ganze Welt liefern, und die Lieferkosten. Also das, was bei Kickstarter übriggeblieben ist, ist nur ein klitzekleiner Teil von dem tatsächlich benötigten Geld. Kickstarter ist daher für mich keine Finanzierungsplattform. Es ist eine PR-Plattform.
Suchen Sie denn noch Investoren?
N.H.: Nein, wir haben bereits fantastische Investoren an Bord, die uns unterstützen und mit ihrem Netzwerk helfen. Wir haben letztes Jahr 20 Millionen Euro an Investmentgeld bekommen. Für deutsche Verhältnisse ist das sehr viel.
Ist München ein so investmentfreundliches Gebiet?
N.H.: Eigentlich nicht. Die Münchner Investoren sind eher glücklich, wenn sie in Immobilien investieren können – was typisch ist für ganz Deutschland. Statt Arbeitsplätze für die Kinder und Enkel zu schaffen, wird lieber in Wohnraum für sie investiert. Mir fehlt hier so ein bisschen die Mentalität der Gründerzeit, wie sie in Deutschland in den 50er Jahren geherrscht hat. Wenn ich irgendwann alt werde und zurückschaue, dann will ich sagen: Ich habe den Menschen einen Platz zum Arbeiten gegeben in einem Unternehmen, das sie toll finden und wo sie die Möglichkeit haben, viel zu lernen. Ich will am Ende nicht sagen, ich habe viele Gebäude. Das wäre für mich furchtbar. Ich wohne übrigens zur Miete, habe keine einzige Immobilie.
In ein Gerät wie The Dash fließt Wissen der unterschiedlichsten Fachrichtungen ein. Wie schafft man es, die Experten aus den verschiedenen Feldern unter einen Hut zu bekommen?
N.H.: Wir haben eine holokratische Unternehmensstruktur, das heißt, wir haben keine Silos mit den verschiedenen Fähigkeiten, sondern wir bauen querfunktionale Projekte auf. In jedem Projekt sitzen ein Designer, ein Programmierer und ein Hardwareentwickler. Abhängig davon, wo das Projekt gerade steht, werden die Leute einbezogen und wieder herausgenommen. Die Designer verfolgen das Projekt bis zum Schluss und die Softwareleute sind von Anfang an mit dabei.
Welche Hürden hatten Sie denn aus technologischer Sicht zu überwinden?
N.H.: Da gab es mehrere. Wir mussten das Produkt aus möglichst kleinen Komponenten aufbauen. Mit einem eigens für uns entwickelten Chip wäre das einfacher gewesen – aber das wäre zu teuer und wir wären bei eventuellen Änderungen nicht mehr flexibel genug. Daher nutzen wir diskrete Komponenten, die bereits existierten. Heute haben wir in The Dash 27 Sensoren – die Integrationsdichte ist der absolute Hammer. Als wir angefangen haben, sagten die meisten Experten, dass das nach dem Stand der Technik so nicht machbar wäre …
Insgesamt sind in dem Gerät fünf Weltneuheiten realisiert, die es in der Größe und Komplexität so bisher nicht gegeben hat. Zum Beispiel haben wir ein nur fingernagelgroßes Pulsoximeter integriert – bisher sind das relativ große Kisten, die in Krankenhäusern stehen. Dann ist die Kommunikation zwischen den beiden Ohr-Plugs über eine Manipulation des Magnetfeldes realisiert – heute können wir so Musik und Daten in hoher Qualität übertragen.
Insgesamt haben wir eine extrem hohe Integrationsdichte erreicht – in jedem Plug stecken rund 90 Elektronikkomponenten. Wir haben elf verschiedene Lagen und in jeder Lage ist eine Toleranz von maximal 0,01 Millimeter erlaubt. Fertigungstechnisch für uns absolut eine Herausforderung.
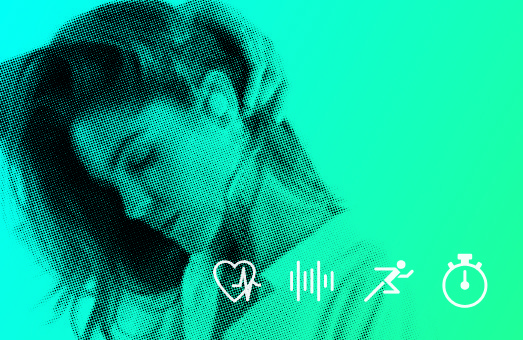
Welche Rolle hat EBV bei dem ganzen Projekt gespielt?
N.H.: EBV hat uns sehr bei der Lösung der Kommunikation zwischen dem linken und rechten Ohr-Plug unterstützt. Sie haben mit uns die Lieferanten von unserer Idee überzeugt. Als Sprachrohr zu den Lieferanten hat uns EBV sehr geholfen, denn auch die Lieferanten mussten erheblich investieren, um die benötigten Komponenten für uns bereitstellen zu können.
Wie sehen Sie die Zukunft für derartige Wearables?
N.H.: Irgendwann werden wir alle tragbare Computer haben – keine Handys, keine Fernseher. Stattdessen werden wir elektronische Kontaktlinsen im Auge und einen Stöpsel im Ohr als tragbare Computer haben. Wir werden überall auf dem Körper Sensoren haben. Noch innerhalb unserer Generation werden Industrien und Unternehmen verschwunden sein, die diese Änderungen nicht erkannt haben. Das wird ein Riesenwandel.
(Bildnachweis: Bragi)