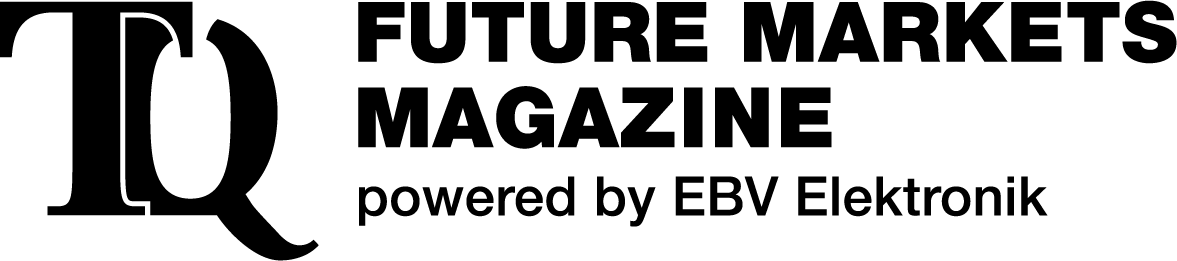Smarte Städte sind lebenswert, ziehen junge, gut ausgebildete Menschen und damit auch innovative Arbeitgeber an. Smartness wird damit entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt. Doch der Weg dorthin kann ganz unterschiedlich aussehen.
Die Zukunft der Stadt wird digital sein – dessen sind sich alle Teilnehmer des Expertengesprächs einig. „Elektronik wird sich überall in der Stadt befinden, und die eingesetzten Geräte werden multifunktional sein“, ist sich Ramin Lavae Mokhtari sicher, CEO und Gründer von ICEGateway, einem Hersteller von smarten, multifunktionalen Straßenleuchten. Bei der Frage, was genau eigentlich eine Smart City ist, gibt es unterschiedliche Ansichten. Mokhtari zum Beispiel sieht eine Smart City zunächst einmal als reine digitale Infrastruktur, die nach der Installation jederzeit für Segmente wie Energie, Sicherheit, Verkehr und Marketing ausgebaut werden kann: „Sie steht Tag und Nacht zur Verfügung und sammelt ortsbezogene Daten für die Stadt. Verschiedene Applikationen können schrittweise nach Bedarf eingeführt werden.“ Anne-Caroline Erbstößer, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Technologiestiftung Berlin, fasst den Begriff weitaus größer: „Die Smart City ist ein Konzept für die Stadt der Zukunft. Der Begriff soll verschiedenste Bereiche zusammenfassen, im Fokus stehen dabei vor allem die Mobilität, die Energie und der digitale Layer, der über dem Ganzen liegt und alle Bereiche verbindet.“ Für Karl Lehnhoff, Leiter des Bereichs Smart Grid bei EBV Elektronik, ist das oberste Ziel, die Lebensqualität der Bewohner zu erhöhen oder zumindest auf gleichem Niveau zu halten – trotz des zu erwartenden Zuzugs vieler weiterer Menschen in die Städte.
Lebensqualität auch im Umfeld sichern
Die Urbanisierung findet ihr Gegenstück darin, dass sich die Bevölkerung in ländlichen Gebieten ausdünnt. Axel Schüßler, Zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes Smart City, weitet das Thema Smart City daher auch auf kleine Städte und ländliche Regionen aus und spricht von Smart Communities: „Auch dort soll die Lebensqualität erhalten bleiben und sollen den Bürgern Services zur Verfügung stehen, wie man sie heute schon aus den größeren Städten kennt.“ Diese Sichtweise bestätigt Professor Jochen Kreusel, Leiter Market Innovation der Division Power Grids bei ABB: „Viele Dinge, die wir unter dem Begriff Smart City diskutieren, können durchaus dazu beitragen, dass die Menschen auf dem Land wohnen bleiben. Es geht also tatsächlich nicht nur um das Handeln in der Stadt selbst, sondern auch darum, das Umfeld lebensfähig zu halten.“
Unterschiedliche Herangehensweisen
Wie man nun aber zu einer Smart City oder Smart Community kommt, da gehen die Meinungen auseinander: „Grundsätzlich kann man zwischen zwei Herangehensweisen unterscheiden“, so Prof. Jochen Kreusel. „Bei dem einen Weg werden zunächst einmal Sensoren implementiert und es wird eine Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut. So erhält man mehr Informationen, die dann von Dritten, zum Beispiel Dienstleistern, genutzt werden können.“ Man weiß also noch gar nicht unbedingt, was mit den Informationen gemacht werden kann, sondern es wird erst einmal eine Datenbasis aufgebaut. „Man schafft so einen Markt für neue, informationsbasierte Dienstleistungen“, so Kreusel. „Der andere Ansatz ist, dass die Stadt die Informations-Infrastruktur selber nutzt und auch der Besitzer des Netzes ist. Hier steht im Fokus, dass die Stadt ihre eigenen Dienste optimieren möchte.“
Erfahrungen aus der Praxis
Für beide Ansätze gibt es heute bereits Beispiele: Ramin Mokhtari nennt die Installation von 160 intelligenten Leuchten im Berliner Technologiepark Adlershof, die ICE Gateway auf Basis von M2M-Netzen der Deutschen Telekom aufgebaut hat. Hier gehören die Daten der Betreibergesellschaft Wista Management. Sie werden dann als Smart City Factory für verschiedene Applikationen zur Verfügung gestellt und schrittweise erweitert. Die gesamte Installation amortisiert sich in rund fünf Jahren durch die Energieeinsparung. Auch Telefónica-Experte Koltermann nennt ein Beispiel: In Santander bestand der erste Schritt darin, 20.000 Sensoren zur Erfassung der unterschiedlichsten Werte über das gesamte Stadtgebiet verteilt zu installieren und deren Messwerte über ein Portal zur Verfügung zu stellen. Den anderen Weg ging laut Koltermann Valencia. Hier wurden die bereits in der Stadt vorhandenen Daten in ein Open Data Portal gestellt und so für Bürger nutzbar gemacht. „In den meisten Städten liegen bereits sehr viele Daten vor“, so die Erfahrung von Karl Lehnhoff. „Stellt man sie in einem Portal bereit, wird sich dazu auch ein entsprechendes Business entwickeln und Firmen werden Apps programmieren, die diese Daten nutzen.“ Dass das funktioniert, berichtet Koltermann: „Wir haben zum Beispiel zusammen mit einer Stadt – ebenfalls in Spanien – ein Portal aufgebaut, in das die Stadt dann nur Daten zum Wetter und zu Wassertemperaturen hochgeladen hat. Sie hatte aber darüber hinaus kein Geld, um entsprechende Apps zu entwickeln. Daher hat man die Daten über das Portal frei zugänglich gemacht. So konnten Entwickler der örtlichen Universität darauf zugreifen und beispielsweise eine App designen, über die sich Touristen informieren können.“ Als Basis des Portals dient die Plattform der Fiware-Allianz: Fiware, von manchen als die „Europäische Cloud“ bezeichnet, bietet neben einer offenen Cloud-Computing-Infrastruktur auch eine Sammlung von Werkzeugen bzw. Diensten zur Entwicklung von Internetanwendungen. Die Lösung stellt damit eine Alternative zu herstellerspezifischen Internetplattformen wie beispielsweise Google oder Amazon dar. „Für Städte hat Fiware den Vorteil, dass keine Lizenzkosten anfallen, die Daten gesichert abgelegt werden und das typische Abteilungsdenken, wie es heute in Städten existiert, überwunden werden kann“, so Sven Koltermann. Das Wegkommen von diesem Silo-Denken ist essentiell, meint auch Axel Schüßler: „Bei vielen Projekten werden heute einzelne Services realisiert, ohne dass nach links und rechts geschaut wird. Doch wir brauchen Lösungen, bei denen in Schichten gedacht wird.“ Das erfordert entsprechende Daten- oder Internet-of-Things-Plattformen, in denen alle Zugriffe auf Geräte beziehungsweise Datennutzung über Rollen- und Berechtigungskonzepte unterstützt werden – so wie sie Schüßler mit seinem Start-up IoT Connctd zum Beispiel für den Smart Building & Home Bereich anbietet. „So lassen sich einmal aufgebaute Geräte beziehungsweise erzeugte Daten grundsätzlich wiederverwenden – derartige Plattformen ermöglichen sozusagen ein digitales Recycling.“
Internet versus Intranet
Allerdings ist das Thema Daten immer mit einem gewissen Unbehagen bei den Bürgern verbunden – wer erfasst die Daten, wer hat Zugriff darauf und welche Daten werden überhaupt gesammelt? „Wenn eine Stadt einfach nur das Internet nutzt, um eine Smart-City-Infrastruktur aufzubauen, ist das meiner Ansicht nach sehr gefährlich. Denn dann werden die Daten nämlich nicht von der Stadt, sondern von ganz anderen Akteuren gesammelt“, meint Ramin Mokhtari. Er ist daher der Ansicht, dass die Stadt eine eigene Kommunikationsstruktur aufbauen muss. „Eine Stadt muss einfach über mehr lokale Informationen verfügen, besser Bescheid wissen, was in ihr geschieht. Und die Stadt sollte derjenige sein, der dann entscheidet, welche Informationen davon an wen freigestellt werden. Das erfordert B2B-Strukturen, die parallel zum reinen Internet aufgebaut werden müssen – wobei das Internet als Kommunikationsnetz für B2C-Dienste dienen kann.“
Wer ist der bessere Daten-Provider?
Auch Anne-Caroline Erbstößer sieht Vorteile, wenn die Stadt selbst die Datenhoheit hat: „Die Stadt ist ein erfahrener Daten-Provider und hat auch beim Handling von personenbezogenen Daten eine gewachsene Akzeptanz bei den Bürgern. Die Stadt tut gut daran diese Akzeptanz auszubauen. Dafür sollte sie die Digitalisierung aktiv mitgestalten und sich für neue Technologien öffnen, aber vor allem bei heiklen Daten sollten Städte nicht uneingeschränkt anderen Akteuren das Feld überlassen.“ Wobei Sven Koltermann, dessen Arbeitgeber Telefónica ja als ein derartiger „externer“ Dienstleister fungiert, das etwas anders sieht: „Ich halte nichts davon, wenn Städte sich abschotten. Und das Internet ist heute bereits vorhanden, genauso wie Mobilfunknetze. Die darüber verfügbaren Daten sollte man auch nutzen.“ Was Telefónica auch macht – wobei die Daten der Mobilfunkkunden so anonymisiert werden, dass sie nicht zurückzuverfolgen sind. „Auch dann kann man noch sehr viel mit den Daten anfangen – anonymisierte und aggregierte Standortdaten können zum Beispiel für Verkehrsleitsysteme genutzt werden oder Roaming-Informationen als Basis maßgeschneiderter Dienste für Touristen.“ Unterstützung erhält Koltermann von Axel Schüßler: „Schon im Hinblick auf die Nachhaltigkeit muss ich nicht eine dritte oder vierte parallele Infrastruktur aufbauen. Allerdings sollten dann die Daten in einem strukturierten Prozess – im Hinblick auf den Datenschutz – zur Verfügung gestellt werden.“ Mokhtari betont, dass er eine städtische Lösung nicht als Abschottung sieht, sondern als notwendiges Tool, um bei Bedarf auch eigene Entscheidungen treffen zu können. Grundsätzlich, so Schüßler, haben aber unterschiedliche Aufgaben auch verschiedene Anforderungen an die Kommunikations-Technologie, zum Beispiel in puncto Bandbreite oder Latenz: „Die verschiedenen Infrastruktur-Technologien eignen sich damit für die diversen Aufgaben einer Smart City unterschiedlich gut.“
Zähe Umsetzung von Innovationen
Wie auch immer die Smart-City-Infrastruktur aussieht – sie erfordert auf jeden Fall Investitionen in Sensoren, Kommunikationstechnik oder Cloud-Plattformen. Die entsprechenden technischen Lösungen dazu sind da, auch in Form von handfesten Produkten. Doch ist die Denkweise hinsichtlich Investitionen in vielen Städten noch nicht in der smarten Welt angekommen. „Es gibt noch genügend Städte, bei deren Ausschreibungen der kostengünstigste Anbieter den Zuschlag erhält“, so die Beobachtung von Karl Lehnhoff. Er nennt als Beispiel die Straßenbeleuchtung: „Smarte Straßenlampen sind zwar teurer, amortisieren sich aber in drei oder vier Jahren. Zudem sind sie ja durchaus bis zu 25 Jahre in Betrieb – da sollte eine Stadt doch nicht nur die Anschaffungskosten im Blick haben, sondern eine Lösung bevorzugen, die zum Beispiel mit integrierten Ladestationen auch zukunftssicher ist.“ Auf der anderen Seite gibt es aber auch Städte, die interessiert sind und die Zukunft im Blick haben, so Kreusel: „Allerdings ist es für viele Städte eine große Hürde, vor einer Investition mit der Wirtschaft zu reden und Know-how zu sammeln.“ In der Technologiestiftung Berlin hat man ähnliche Erfahrungen gemacht, wie Anne-Caroline Erbstößer erzählt: „Es ist sehr zäh, Innovationen in die Köpfe der Verantwortlichen in den Stadtgremien zu bringen.“ Das sei allerdings nicht reine Sturheit, sondern oftmals auch die Sorge, sich von bestimmten Technologien abhängig zu machen – denn wer weiß schon, ob neue, innovative Produkte in zehn oder zwanzig Jahren noch unterstützt werden beziehungsweise ob sie dann noch interoperabel sind? „Viele Städte investieren heute noch nicht, weil sie sehen, wie rasant die Entwicklung voranschreitet und die Preise sinken“, so Ramin Lavae Mokhtari. „Wenn sie mit der Investition warten, dann erhalten sie ein ausgereiftes Produkt zu einem Bruchteil des Anfangspreises.“ Doch es ist nicht nur damit getan, sich Know-how anzueignen und Technik zu kaufen, wie Professor Kreusel betont: „Sollen die viel zitierten Silos in der städtischen Organisation überwunden werden, dann muss auch die Organisation selbst angepasst werden.“
Den Bürger abholen
Eine weitere wichtige Frage muss bei einem Smart-City-Projekt berücksichtigt werden, meint Sven Koltermann: „Wie hole ich den Bürger ab? Man muss ihm klarmachen, welchen Mehrwert die entsprechenden Dienste für ihn bringen.“ Dazu ist es wichtig, dass sich die Stadt selbst Gedanken darüber macht, welche Funktion sie eigentlich hat und was sie für den Bürger tun soll. Erbstößer nennt hier die Daseinsvorsorge als die wesentliche Aufgabe der Stadt – nämlich dafür zu sorgen, dass ihre Bürger Licht, Strom, Wasser, schnelles Internet und eine Verwaltung für bestimmte Grundaufgaben haben. „Eine Stadt sollte ihre Bürger einfach fragen, was deren drängendsten Probleme sind. Dann kann sie ihren Bewohnern auch verständlich machen, wie mit Smart-City-Lösungen diese Probleme gelöst werden können und warum Geld dafür ausgegeben wird.“ Wenn die Fragen der Einwohner oder Unternehmen einer Stadt aber in den Mittelpunkt des Veränderungsprozesses gestellt werden, dann wird jede Smart City eine andere Ausprägung haben, erklärt Axel Schüßler. „Das wird in Berlin ganz anders aussehen als in einem Ort im Schwarzwald oder in einer neu konzipierten Stadt in China.“
Langfristige Politik gefragt
Dabei muss eine Stadt auch langfristig denken und übergeordnete Ziele im Blick haben, wie Anne-Caroline Erbstößer betont. „Der Zeitrahmen, eine Stadt in eine Smart City umzuwandeln, umfasst sicherlich mehrere Jahrzehnte“, meint denn auch Karl Lehnhoff. „Gleichzeitig muss man aber heute die Ziele definieren“, betont Anne-Caroline Erbstößer. So wie es Berlin gemacht hat: Im Energiewendegesetz vom April 2016 wurde festgelegt, dass das Land Berlin bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. „Damit können jetzt die notwendigen Technologien beschafft werden und es kann der zur Erreichung des Ziels notwendige Betrag berechnet werden.“ Die langen Zeitspannen, in denen bei der Realisierung einer Smart City gedacht werden muss, erfordern allerdings einen konstanten politischen Führungswillen über viele Jahre. Damit ist die Smart City letzten Endes eine Aufgabe des Bürgermeisters und Anne-Caroline Erbstößer mahnt: „Wenn die politische Führung alle paar Jahre wechselt und der jeweilige Bürgermeister ganz andere Vorstellungen von einer Smart City hat, dann wird die Realisierung extrem schwierig.“
(Bildnachweis: IndustryAgents: Dominik Gierke)