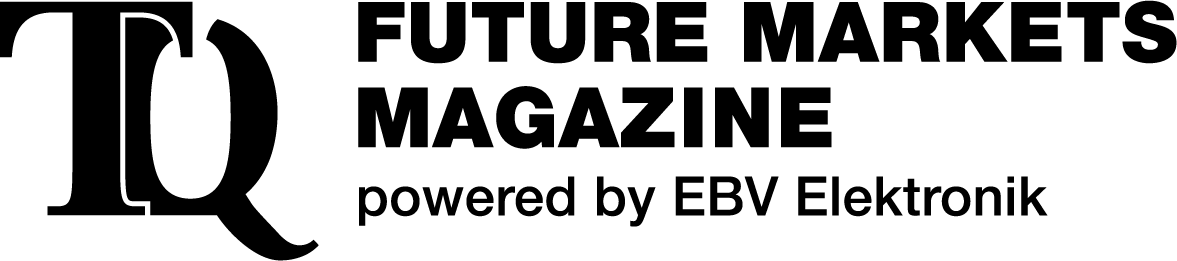Die Technik ist vorhanden, Standardisierung und Datenschutz sind kein Hindernis auf dem Weg zur Industrie 4.0, so die Experten des Round-Tables. Die größte Herausforderung ist es, sinnvolle Anwendungen für die vernetzte Produktion zu definieren, die sich auch wirtschaftlich rechnen.
Aus technologischer Sicht ist Industrie 4.0 keine wirkliche Revolution – da sind sich die Teilnehmer der Expertenrunde schnell einig: „Cyber-physische Systeme, also die Kombination von Hardware, Software und Kommunikationsfähigkeit, gibt es schon eine ganze Weile“, meint Georg Kube, Global Vice President Industrial Machinery and Components bei SAP. Er sieht in der Industrie 4.0 daher eher eine stark beschleunigte Evolution, weniger eine Revolution. Auch Prof. Dr. Alexander Ferrein, der an der Fachhochschule Aachen das Institut für Mobile Autonome Systeme & Kognitive Robotik leitet, meint, dass die für Industrie 4.0 benötigten Technologien schon vorhanden sind und verwendet werden: „Neu ist, dass diese Technologien immer günstiger geworden sind und jetzt auch für kleinere Unternehmen wirtschaftlich interessant sind.“ So kann heute immer mehr Sensorik im klassischen Maschinenbau eingesetzt werden – die Grundlage dafür, dass Geräte intelligent werden und autonom in unstrukturierten Umgebungen agieren können. Für Prof. Ferrein, der sich in seiner Forschung auf Künstliche Intelligenz und Kognitive Robotik konzentriert, ist das die Basis für eine wesentliche Innovation in der Industrie 4.0: „Gerade beim Thema Kollaboration zwischen Mensch und Maschine oder Roboter werden wir in naher Zukunft dadurch einen großen Schritt weiterkommen.“ Diese Ansicht teilt auch Dr. Wilfried Kugler, Vice President Operations bei viastore, einem international führenden Anbieter von schlüsselfertigen Lagersystemen und Warehouse Management Software: „Wir vernetzen unsere Anlagen schon seit 15 Jahren. Das ist für uns also nichts Neues. Natürlich werden heute auch schon Roboter im Lager eingesetzt, zum Beispiel beim Kommissionieren oder Packen von schweren Waren. Allerdings noch kaum im Sinne eines Assistenzsystems, das mit dem Menschen zusammenarbeitet und ihn unterstützt – ein typisches Industrie 4.0-Thema. Da sehe ich noch viel Potenzial.“ Auch Thomas Staudinger, Vice President Vertical Segments and Technical Marketing bei EBV Elektronik, betont, dass in der Regel kein spezifisches Industrie 4.0-Produkt entwickelt werden muss. „Meistens sind das Geräte, die es heute schon gibt, die aber um Connectivity und Security-Funktionen ergänzt werden. So entstehen aus bereits heute verfügbaren Technologien spannende neue Ideen.“ Genau hier sieht er auch das Revolutionäre des Themas Industrie 4.0: „Beim Thema Industrie 4.0 kommen viele Dinge zusammen, die es schon länger gibt und die sich jetzt gegenseitig verstärken.“ Beispiele hierfür sind das Internetprotokoll in der Version 6, mit dem plötzlich eine gigantische Zahl von IP-Adressen für die Vernetzung von Gegenständen zur Verfügung steht, oder die stark gefallenen Kommunikationskosten für den Mobilfunk.
Sinnvolle Business Cases finden
Allerdings darf Industrie 4.0 nicht nur Selbstzweck sein, so Dr. Kugler. „Wenn der Kundennutzen nicht da ist, nützt uns die tollste Technologie nichts. Es geht in erster Linie um Durchsatz, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.“ Mit der Frage nach dem Nutzen der Industrie 4.0 wird Georg Kube regelmäßig konfrontiert: „Durch den Hype um das Thema sind viele Unternehmen auf Industrie 4.0 aufmerksam geworden und fragen sich – und uns – wie sie die Technologien für sich nutzen können.“ Oftmals muss dafür noch nicht einmal neue Hardware eingebaut werden, wie Kube berichtet: „Ein Kunde von uns, ein Chemiekonzern, hat über Jahre sämtliche Sensordaten und alle Wartungsprotokolle seiner Anlage mitgeschrieben und gespeichert, wusste aber nicht genau, was er damit anfangen sollte. Wir konnten diese Daten über entsprechende Analyseverfahren abgleichen und nach Mustern durchsuchen, die auf einen nahenden Ausfall zum Beispiel einer Pumpe hinweisen. Die Anlage lässt sich nun warten, bevor es zu einem Ausfall kommt.“ Dadurch können Wartungskosten reduziert werden – und die Investition in die entsprechende Technologie rechnet sich. Genau darin sieht Kube die größte Herausforderung der Industrie 4.0 – sinnvolle Business Cases zu finden.

Vielfältiger Nutzen
Auch Thomas Staudinger meint, dass Industrie 4.0 nur Erfolg haben kann, wenn zwischen den Kosten für die Implementierung und dem Nutzen abgewogen wird: „Wenn ein smartes Produkt zehn- oder zwanzigmal so viel kostet, wird es schwierig, Argumente dafür zu finden. Wenn ich aber zum Beispiel in einen 5.000 Euro teuren Motor einen Sensor, einen Mikrocontroller und eine Kommunikationsschnittstelle für fünf Euro einbaue, die mich vor einem drohenden Schaden des Motors warnen, dann habe ich einen Mehrwert, den der Kunde auch bereit ist zu bezahlen.“ Wobei der Nutzen von vernetzten Produkten in der Industrie 4.0 durchaus von unterschiedlicher Natur sein kann, wie Dr. Kugler erklärt: „Es geht zum einen auch darum, Produkte günstiger herstellen zu können. Industrie 4.0 kann aber auch dazu beitragen, die Qualität in den Prozessen und in dem Produkt zu steigern.“ Georg Kube nennt die Individualisierung des Fertigungsprozesses als einen anderen Nutzen: „Mit Industrie 4.0 ist es möglich, ein Produkt individuell zu konfigurieren und es schnell in die Fertigung zu bringen – zu Kosten, die denen einer Massenfertigung nahekommen.“ Insgesamt sieht der SAP-Manager drei Zielrichtungen von Industrie 4.0-Maßnahmen: Produkte günstiger anbieten zu können, neuen Umsatz durch neue Services zu generieren oder mehr Produkte zu verkaufen, indem der Kunde sie individualisieren kann.

Vorausschauende Wartung eine Kernanwendung
Gerade im Bereich Service sieht Kube große Chancen: „Aus meiner Sicht eine Kernanwendung für Industrie 4.0; entsprechende Applikationen entstehen auch zurzeit.“ Hierzu kann Wilfried Kugler ein aktuelles Beispiel aus seinem Unternehmen geben: „Wir arbeiten momentan an einer Lösung, bei der wir Agenten in unsere Software-Systeme implementieren und sie mit unserem Service-Center vernetzen. Die Software-Agenten spüren kommende Probleme in der Anlage des Kunden auf und melden sich aktiv bei unserer Servicezentrale. Ein Servicetechniker kann, bevor überhaupt etwas passiert, vor Ort aktiv werden. Dieses Plus an Anlagenverfügbarkeit bieten wir dem Kunden als zusätzlichen Service an – und er ist auch bereit, für diesen Nutzen zu zahlen.“ Doch Service wird nicht die traditionelle Fertigungsindustrie ersetzen – da ist sich Prof. Ferrein sicher: „Irgendjemand muss letztendlich produzieren. Eine Idee von Industrie 4.0 ist zwar, dass die Grenzen zwischen Maschine und Service sich auflösen und es keine definierten Produktions-Standorte geben wird, doch das sehe ich nicht. Denn das heutige produzierende Gewerbe verfügt über viel Know-how zur Fertigung ihrer Produkte – das lässt sich nicht so einfach in die Cloud verlagern.“ Dennoch ermöglicht die Cloud-Technologie, zusammen mit der hohen Qualität der Kommunikationsnetze, völlig neue Möglichkeiten. „Schon heute ist es möglich, ein Lager in Singapur von einem Rechenzentrum in Deutschland aus im Detail zu steuern“, so Dr. Kugler. „Die spannende Frage ist also, welche Dienste überhaupt noch in einer Anlage gehalten werden müssen und welche Dienste über die Netze oder die Cloud abgewickelt werden können?“
Mit dem richtigen Bewusstsein ist Datenschutz zu bewerkstelligen
Dabei stellt sich aber auch eine andere Frage, auf die Thomas Staudinger aufmerksam macht: „Wem gehören denn dann die Daten – dem Kunden, bei dem die Daten anfallen, oder dem Dienstleister, der sie in seinem Rechenzentrum analysiert?“ Die Experten am Tisch sind sich einig, dass diese Frage vertraglich zwischen Kunden und Dienstleister genau geklärt sein muss. Gesetzliche Regelungen sehen sie dafür zwar als hilfreich, aber nicht als notwendig an. „Bei Zugriffsrechten und Datenschutz helfen Gesetze immer nur begrenzt. Das muss vertraglich geregelt werden und setzt ein Vertrauensverhältnis zwischen IT-Lieferant, Systemintegrator und Kunden voraus“, so Wilfried Kugler. Georg Kube ergänzt zudem, dass die Auslagerung von Daten oder Prozessen in die Cloud nicht unbedingt unsicher ist. „Vor allem für mittelständische Unternehmen ist es sehr schwer, ihre Server vor Cyberattacken abzusichern. Bei Cloud-Anbietern gehört die IT-Sicherheit dagegen zum Kerngeschäft – daher ist eine Cloud-Umgebung oftmals besser abgesichert als eine individuelle IT.“
Cybersecurity in Sicherheitskonzepte einbinden
„Natürlich wird das Risiko rund um das Thema Cybersecurity höher, wenn zunehmend autonome Komponenten in der Industrie an das Internet angebunden werden“, räumt Thomas Staudinger ein. Er ist sich aber auch sicher, dass es hierfür gute Lösungen gibt: „Über entsprechende Software- und Hardware-Maßnahmen können das System und die Daten geschützt werden.“ Dafür müsse allerdings genau definiert werden, was geschützt werden soll: Soll eine Manipulation der Fertigung, der Diebstahl von Firmendaten oder die Kopie eines neuen Produktes durch einen Wettbewerber verhindert werden? „Die Technologien für all diese Aufgaben sind heute schon vorhanden“, so Staudinger. „Sie sind nur noch nicht überall in die Sicherheitskonzepte eingebunden.“ Doch die aktuelle Diskussion um das Thema Industrie 4.0 kann hier eine Chance bieten, meint Prof. Ferrein. „Vielen Unternehmen aus der klassischen Industrie sind die existierenden Sicherheitsproblematiken überhaupt noch nicht klar. Industrie 4.0 sollte daher auch genutzt werden, um zu diesem Thema eine Aufklärungskampagne zu starten.“

Standardisierung ist hilfreich, aber nicht notwendig
Ähnlich wie beim Datenschutz sehen die Round-Table-Teilnehmer auch bei der Frage der Standardisierung nicht zuerst übergeordnete Instanzen in der Pflicht. „Ich glaube nicht, dass man eine Standardisierung im Rahmen der Industrie 4.0 abwarten kann“, meint Thomas Staudinger. „Denn sonst drohen die USA oder andere Länder uns bei der Umsetzung des Konzeptes zu überholen.“ Wilfried Kugler ist der gleichen Meinung und ergänzt: „Wir haben heute bereits viele standardisierte Technologien wie zum Beispiel das Internetprotokoll, mit denen man gute Industrie 4.0-Lösungen realisieren kann.“ Georg Kubes Fazit zur Standardisierungsdiskussion: „Standards wären wünschenswert und hilfreich, aber nicht notwendig. Fehlende übergreifende Standards werden Industrie 4.0 nicht aufhalten.“
Fachkräfte müssen zunehmend im System denken
Doch was bedeutet das für den Menschen, der in der Industrie 4.0 arbeitet? „Auf jeden Fall wird sich die Ingenieursausbildung ändern“, meint Georg Kube. Denn vernetzte, autonome Produkte werden Maschinenbau, Software und Elektronik in sich vereinen. Entsprechend müssen zukünftige Ingenieure noch mehr im System denken, als sie es heute tun, meint Kube. „Doch zwischen dem Vorgehen und der Arbeitsweise von Maschinenbauern und Informatikern liegen Welten – daher muss man die Bereiche noch stärker zusammenbringen.“ Dies geschieht schon heute in der Ausbildung an den Hochschulen, wie Prof. Alexander Ferrein betont. „Ohne IT geht es schon heute nicht mehr in der Fertigung und Automatisierung. Wichtig ist, den zukünftigen Ingenieuren zu vermitteln, ein komplexes System in seiner Gesamtheit zu erfassen. Natürlich kann nicht jeder alles beherrschen. Aber die unterschiedlichen Fachrichtungen müssen lernen, miteinander zu reden und die Zusammenhänge zu verstehen.“

Erfahrene Facharbeiter werden weiterhin gebraucht
Auch für den Facharbeiter in der Fertigung wird sich die Arbeitswelt durch Industrie 4.0 verändern – positiv, wie sich Wilfried Kugler sicher ist: „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden die Facharbeiter in der Fabrik immer älter. Im Rahmen von Industrie 4.0 wird es dafür zunehmend unterstützende Technologien geben, zum Beispiel Assistenzsysteme wie kollaborative Roboter.“ Parallel dazu wird zunehmend die IT den Menschen in der Fertigung unterstützen – für die heutige ältere Generation vielleicht eine nicht besonders angenehme Vorstellung, doch die nachrückende Generation wird ganz selbstverständlich mit einem Tablet die Anlagen überwachen und steuern, meint Dr. Kugler. „Wobei nicht jeder jetzt IT-Experte sein muss“, betont Prof. Ferrein. „Wir werden auch in Zukunft Menschen brauchen, die zum Beispiel Metall mit der Hand bearbeiten können. Gerade in kleineren Unternehmen, die keine Massenfertigung betreiben, wird man auf diese Leute nicht verzichten können.“ Es wird auch in der Industrie 4.0 keine menschenleere Fabrik geben, so der Tenor der Gesprächsrunde. Doch Thomas Staudinger betont: „Allerdings werden autonome Systeme in Zukunft einfache Arbeiten auch selbstständig ausführen, die Arbeit für ungelernte Facharbeiter wird zunehmend verschwinden. Dem steht allerdings auch gegenüber, dass wir mit einer flexiblen Industrie 4.0 mehr Fertigungsprozesse in Europa halten und damit auch wiederum Arbeitsplätze sichern.“ Für die jetzige Generation an erfahrenen Fachkräften bietet Industrie 4.0 auf jeden Fall eine weitere große Chance, meint Georg Kube. „Irgendwer muss schließlich die Expertensysteme mit Wissen füttern – die erfahrenen Facharbeiter braucht man, um die neuen Anwendungen zu programmieren.“