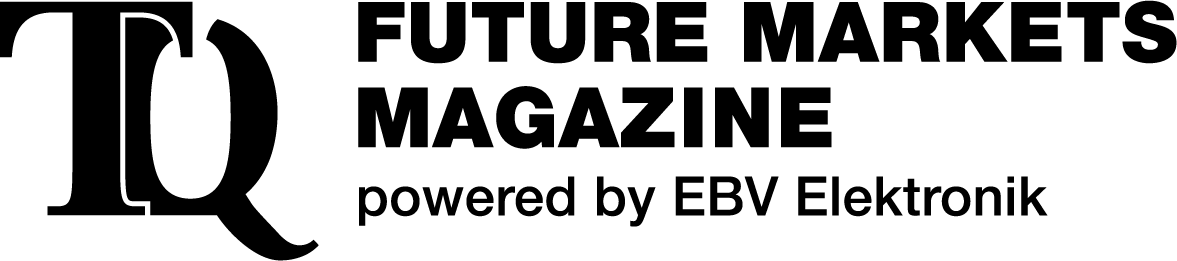Smarte Produkte verbessern vorhandene Systeme, ermöglichen völlig neue Produkte und bilden die Basis für neue Geschäftsmodelle, sind sich die Teilnehmer des Round-Tables einig. Dabei darf jedoch der Mensch nicht vergessen werden – eine positive User-Experience ist bei allen Applikationen ein Entwicklungsschwerpunkt.
Viele Faktoren kommen zusammen, um aus einem technischen System ein smartes System zu machen: Für Erich Brockard, Director Application Central Europe bei EBV Elektronik, ist entscheidend, dass in einem smarten System die Intelligenz verteilt ist – jede Komponente des Systems ist so in der Lage, in einem gewissen Umfang Entscheidungen zu treffen. Für Björn Peters ist das Umwandeln dieser Entscheidungen in eine Aktion ein weiteres Kernkriterium: „Die Basis meiner Definition eines smarten Systems sind intelligente selbstgesteuerte Prozesse“, so der Leiter des Bereichs M2M/IOT bei der exceet Secure Solutions AG. „Dazu gehört auch die automatisierte, sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen, auch von unterschiedlichen Betreibern.“
Intelligenz versus Smartness
Wobei der Begriff Intelligenz nicht ganz unumstritten ist: Guido Stephan, der bei Siemens Leiter des Technologiefeldes Networks and Communication ist, trennt bei der Definition smarter Systeme Intelligenz von Smartness: „Intelligente Wesen sind Menschen. Smarte Systeme dagegen sind in der Lage, Kontexte zu erkennen, innerhalb dieses Kontexts zu wirken und auf unterschiedliche Anforderungen flexibel zu reagieren.“ Zu dieser Kontextsensitivität gehört für ihn, dass die Systeme auf eine Art und Weise reagieren, die über die normale Erwartungshaltung hinausgeht. Neben dem selbstgesteuerten, autonomen Verhalten und der Kontextsensitivität ergänzt Prof. Dr. Elisabeth André noch die Fähigkeit zu planen und auf unbekannte Situationen zu reagieren als ein Merkmal smarter Systeme. Dazu gehört auch, dass die Funktion sich den Bedürfnissen anpasst oder sich über die Lebensdauer des Produktes verändert.
In der Summe ihrer Eigenschaften ermöglichen smarte Systeme vielfältigen Nutzen in den unterschiedlichsten Branchen: In der Industrie liegt der Vorteil vor allem in einer Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen. Maschinen können zum Beispiel statt in festen Intervallen nur dann gewartet werden, wenn das smarte System einen entsprechenden Bedarf meldet. „Die Smartness entsteht hierbei durch die Verbindung der anfallenden Sensordaten aus der Maschine, mit dem Wissen über die jeweiligen Prozesse und Industrie kombiniert mit dem Wissen, wie ein System intern funktioniert“, erklärt Stephan. „So lassen sich Vorhersagen treffen, wann ein Ausfall der Anlage droht.“ Auch das Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschinen dürfte sich verändern, meint Erich Brockard: „Smarte Systeme mit zusätzlicher Redundanz können so sicher sein, dass zum Beispiel ein Roboter direkt mit dem Menschen interagieren kann, ohne durch Schutzzäune von ihm getrennt zu werden.“

Völlig neue Lösungen
Doch es geht nicht nur um die Verbesserung vorhandener Produkte, sondern auch um völlig neue Lösungen. Das beginnt mit dem Smart Grid, das es erst ermöglicht, erneuerbare Energien in die vorhandenen Netzstrukturen einzuspeisen. Ein anderes Beispiel nennt Erich Brockard: Er erzählt, dass in den USA ein Automobilhersteller die Regensensoren in der Scheibenwischanlage seiner Fahrzeuge twittern lässt. Sie melden, wann sie sich einschalten – „durch die Daten, wo zur gleichen Zeit viele Regensensoren reagieren, lassen sich sehr effektiv regionale Wetterkarten erzeugen“, so Brockard. „Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass man einen Regensensor twittern lässt …“
Innovative Geschäftsmodelle
„Wir beobachten zudem, dass Unternehmen mit smarten Systemen auch völlig neue Geschäftsmodelle generieren wollen“, ergänzt Björn Peters. Er entwickelt in seinem Geschäftsbereich unter anderem M2M-Gateways auch für vernetzte Produkte in der Fertigungsindustrie. „Firmen, die bisher im reinen Produktgeschäft unterwegs sind, möchten jetzt über mechatronische Systeme auch mit Services Geld machen.“ Auch im privaten Sektor sehen die Round-Table-Teilnehmer durchaus echten Nutzen für smarte Systeme. „Zwar sind sie im Consumer-Bereich auch ein Stück Spielerei“, meint Prof. André. „Aber sie bieten zudem echte Erleichterung: Will man zum Beispiel in seinem Zuhause Energie sparen, ist das mit smarten Systemen einfacher zu realisieren. Aber auch im Gesundheitsbereich sind diese Technologien sehr wichtig – sie ermöglichen Menschen, länger selbstständig und selbstbestimmt in ihrer Wohnung zu leben.“ Prof. André nennt als Beispiele Systeme, die erkennen, wenn ein Mensch in seiner Wohnung fällt, oder auch Lösungen, die Senioren an die Einnahme von Medikamenten erinnern.
Technische Entwicklungen als Enabler
„Der Bedarf nach smarten Produkten ist da“, betont Björn Peters. „Und der technologische Fortschritt liefert die Lösungen.“ Wesentliche Enabler für smarte Systeme sieht er in der Sensorik, in derMiniaturisierung der elektronischen Bauteile und in der steigenden Rechenleistung. „Die Prozessoren und damit die Chips werden nicht nur immer kleiner, sondern auch immer billiger“, so Brockard. „Zudem kann immer mehr Funktionalität auf einem Chip integriert werden, zum Beispiel Kommunikationsmodule, so dass ein Chip dann schon selbst Informationen austauschen kann.“ Er ist sich sicher, dass dieser Trend auch noch weiter anhält.

Kommunikation je nach Bedarf
Dazu können zukünftige smarte Systeme durchaus die vorhandenen Infrastrukturen nutzen. Dennoch erwartet Guido Stephan im Wireless- beziehungsweise Mobilfunk-Bereich auch völlig neue Funktionen: „Dabei geht es dann aber nicht nur um Bandbreite und möglichst hohe Übertragungsraten. Ein wichtiger Aspekt wird sein, wie man mit einer hohen Zahl von Applikationen zurechtkommt, die nur selten und dann auch nur ein geringes Datenvolumen senden, aber alleine durch ihre Masse einen hohen Traffic erzeugen.“ Björn Peters kann sich dabei vorstellen, dass für die Kommunikation smarter Systeme gar nicht die modernsten Standards wie LTE oder 5G genutzt werden müssen. „Es kommt darauf an, was man übertragen will. Während der Endkonsument nur noch auf Standards wie 4G, 5G oder LTE unterwegs sein will, reicht für die Maschinenkommunikation ja unter Umständen auch ein älterer Standard wie 2G oder 3G aus. Diese Netze sind dann vielleicht auch weniger strapaziert als die aktuellsten Hochleistungsnetze.“ In Zukunft könnten sich die Systeme selbst das passende Netz – oder besser – den passenden Kommunikationskanal suchen. „Zurzeit wird auch viel im Bereich Software Defined Networks und Network Function Virtualization geforscht“, so Stephan. „Hier geht es darum, die Funktion des Netzes von seiner Implementierung zu entkoppeln. Das ermöglicht nicht nur neue Technologien, sondern heute bestehende Netze können auch besser genutzt werden.“
Von Big Data zu Funktionsprofilen
Grundsätzlich betont der Siemens-Experte, dass smarte Systeme nicht nur eine Sache der Hardware sind: „Erst durch die Interaktion zwischen den beiden Disziplinen Hard- und Software entstehen smarte Systeme.“ Als einen wesentlichen Software-Trend nennt er das Schlagwort Big Data oder Smart Data. „Dabei werden die Datenströme in einem bestimmten Kontext betrachtet und algorithmisch oder explizit mit Wissen, wie ein System intern funktioniert, verknüpft. So gewinnt man dann relevante Erkenntnisse.“ Doch Stephan erwartet, dass in Zukunft nicht mehr nur die reinen Daten relevant sind: „Wenn man in der Lage ist, Dinge in ihrem Kontext zu betrachten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, dann kann das auch in einem funktionalen Profil abgebildet werden. Dann lautet die Frage nicht, was Daten sind und was sie bedeuten. Sondern eine Komponente teilt über dieses Funktionsprofil mit, was sie kann.“
Angemessene Sicherheit
Redet man von Daten und Kommunikation, ist man schnell beim Thema Datenschutz und Datensicherheit – auch beim TQ-Round-Table einer der Schwerpunkte der Diskussion. „Nur über Kommunikation ist es möglich, smarte Systeme zu produzieren“, so Erich Brockard. „Aber dann ist es wichtig, dass die Daten an die richtige Adresse gehen und nur von dem gelesen werden, der sie tatsächlich haben soll. Das wird eine der großen Herausforderungen.“ Auch für Björn Peters ist das Thema Security ein wesentliches Element, ein Eckstein smarter Systeme. Allerdings bedeutet das nicht, mit Kanonen auf Spatzen zu feuern, wie er sagt. Sein Unternehmen hat eine Methodik entwickelt, mit der der Schutzbedarf ermittelt und eine Risikoanalyse durchgeführt werden kann. „Wir haben Kunden, die bereits in der Vorentwicklung in einem derartigen Security Assessment einen genauso notwendigen Standard sehen wie zum Beispiel einen EMV-Test.“

Ohne sichere Identitäten keine smarten Systeme
Wesentliches Element jeder Security-Lösung sind sichere Identitäten – damit wird sichergestellt, dass ein System wirklich ist, was es zu sein vorgibt. Hilfreich ist dabei ein entsprechendes Systemdesign, wie Guido Stephan erklärt. So können zum Beispiel Maschinen innerhalb derselben Fabrikhalle frei miteinander kommunizieren. Für die Kommunikation aus der Halle heraus wird im Systemdesign jedoch genau festgelegt, dass nur bestimmte Informationen für bestimmte Nutzer diese Grenzen passieren dürfen. „Man schafft so sogenannte Trusted Ecosystems“, erklärt Björn Peters. „Das sind Kommunikationsräume, in die zwar neue Teilnehmer aufgenommen werden können. Sie müssen aber mit eindeutigen Identitäten versehen sein.“ Das erfordert nicht nur ein aufwändiges Solution Design, sondern auch eine Art von White List, auf der garantiert sichere Geräte oder Subsysteme gelistet sind. „Heutige Systeme können das nicht smart lösen“, so Guido Stephan. „Es wird einfach von Anfang an bestimmt, welche Teilnehmer mit aufgenommen werden dürfen.“ Das muss aber kein Nachteil sein, wie er betont, da dies eine hohe Sicherheit bedeutet. „Beim Blick in die Zukunft muss man sich dann aber die Frage stellen, wie man das Sicherheitsniveau halten und gleichzeitig eine gewisse Smartness realisieren kann. Ohne Identitäten und bestimmte Systemparadigmen wird das nicht möglich sein.“ Daher sollte bei dem Design eines neuen Produktes von vorneherein berücksichtigt werden, dass sie mit anderen Systemen oder dem Internet verbunden sein werden. „Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass immer mehr Geräte miteinander kommunizieren werden und Daten, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind, gehackt werden können“, so Brockard. Allerdings sollte man auch nicht gleich in Hysterie ausbrechen – wie es in Deutschland oftmals passiert –, meint Prof. Elisabeth André: „In Deutschland blockt man oftmals neue Entwicklungen ab und übernimmt letztendlich dann doch Technologien aus den USA, statt sich Gedanken zu machen, wie man ein Produkt designen kann, das unseren Wertevorstellungen und unseren Sicherheitsbedürfnissen entspricht.“

Weiche Faktoren sind entscheidend für die Akzeptanz
Doch nicht nur die Sicherheit muss von Anfang mit bedacht werden, auch der Nutzer selbst sollte bei der Entwicklung smarter Systeme in den Entwicklungsprozess involviert werden. „Das ist besonders wichtig im Smart-Home-Bereich“, so Prof. André. Denn hier nutzen meist Laien ohne besondere Affinität zur Technik die Systeme. „Die Nutzer müssen das Verhalten eines Systems nachvollziehen können, es muss plausibel sein.“ Dazu gehöre dann auch, so die Expertin für Mensch-Technik-Interaktion, dass sich ein System in bestimmten Situationen selbst erklärt, ein Feedback gibt. Guido Stephan gibt dazu ein Beispiel: Er hat zuhause eine Heizung installiert, die über die Zeit lernt, an welchen Tagen er wahrscheinlich das Badezimmer betreten wird und entsprechend das Wasser wärmt. Das macht Sinn, solange er seinen normalen Tagesrhythmus einhält. Verlässt er allerdings diesen Rhythmus, muss er auf warmes Waser warten. „Ich wünsche mir, dass mich das System abends fragt, ob es am nächsten Tag regulär heizen soll“, so Stephan. „Denn Smartness entsteht für mich auch dadurch, dass mich das System darüber informiert, was es in einem bestimmten Kontext tun wird.“ Das führt letztendlich zu einer positiven „User-Experience“ – derartige „weiche Faktoren sind sehr wichtig“, meint Prof. André. „Im Idealfall trägt ein smartes Produkt zum Wohlbefinden bei.“ Bei einigen Anwendungen geht das dann unter Umständen so weit, dass die Maschinen menschliche Eigenschaften nachbilden, zum Beispiel bei Social Robotics, bei denen ein Roboter zum Beispiel einen älteren Menschen durch seinen Alltag begleitet. „Hier wird tatsächlich emotionales Verhalten nachgebildet“, berichtet Prof. Elisabeth André. „Ob man das unbedingt bei Fertigungsmaschinen benötigt, ist ein anderes Thema. Allerdings meinen manche Experten, dass aus dem Bauch heraus oft bessere Entscheidungen getroffen werden. Simuliert man emotionales Verhalten durch Maschinen, könnte dies einen ähnlich positiven Effekt haben. Letztendlich muss man wissen, wann die Nachbildung von Emotionen bei technischen Systemen einen Mehrwert bietet und wann nicht.“
Auch wenn eine derartige „emotionale Intelligenz“ bei den meisten smarten Systemen nicht benötigt wird, wird das Thema Mensch-Maschine-Interaktion ein Kern zukünftiger Entwicklungen sein, ist sich Guido Stephan sicher: „Die Frage, wie man die Sinne von Menschen für die technische Interaktion mit Systemen nutzt, wird eine entscheidende Rolle spielen in der Zukunft. Und diese Zukunft ist nicht fern.“