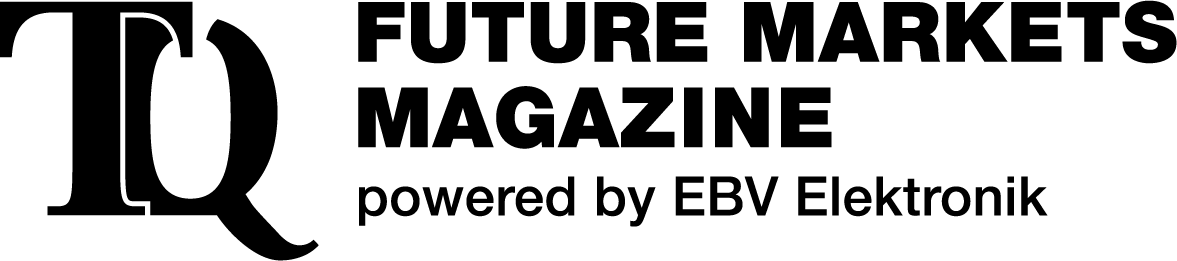Der aktuelle Chip-Engpass hat deutlich gemacht, wie empfindlich die komplexen Halbleiter-Lieferketten auf Störungen reagieren. Politik, Halbleiterindustrie und Unternehmen, die Chips für ihre Produkte benötigen, ergreifen nun verschiedene Maßnahmen, um die Resilienz der Lieferketten zu steigern.
Konsum-Boom meets Lieferengpässe: So lässt sich die aktuelle Situation im Welthandel kurz zusammenfassen. Insbesondere bei der Versorgung mit Halbleiterprodukten traten in den letzten Monaten große Engpässe auf, die zumindest teilweise wohl auch noch bis ins Jahr 2023 andauern werden.
Halbleiterindustrie erweitert Kapazitäten
Die Halbleiterindustrie reagierte bereits, erhöhte die Auslastung der vorhandenen Fabriken und steigerte damit das Volumen der produzierten Halbleiterprodukte. Auch wurden spezielle „Kommandozentralen“ eingerichtet, um die dringendsten Kundenanfragen zu bearbeiten und um in enger Zusammenarbeit mit den Kunden Doppelbestellungen zu vermeiden. Mit Erfolg, wie der Europäische Verband der Halbleiterindustrie (ESIA) berichtet, denn der weltweite Halbleiterumsatz stieg im Jahr 2021 um 26,2 Prozent gegenüber 2020 an. „Die Rekordzahlen, die der Halbleitermarkt im Jahr 2021 erreicht hat, zeigen, dass die Branche auf das beispiellose Wachstum der weltweiten Halbleiternachfrage reagiert“, erklärt Hendrik Abma, Generaldirektor der ESIA. So konnten die Kunden kurzfristig schneller und effizienter mit Produkten beliefert werden. Für eine langfristige Sicherung der Versorgung planen die Chiphersteller darüber hinaus, weltweit mit hohen Investitionen neue Produktionskapazitäten zu schaffen.
Kleine Hersteller nutzen ihre Chance
Parallel dazu ist laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Global zu beobachten, dass die Risikokapitalinvestitionen in Halbleiter zunehmen – das betrifft vor allem Unternehmen, die neue Arten von Chips herstellen, zum Beispiel mit besonderen Funktionen für spezielle Anwendungen. Deloitte Global prognostiziert, dass Risikokapital-Geber im Jahr 2022 weltweit mehr als sechs Milliarden US-Dollar in neu gegründete Halbleiterunternehmen investieren werden. Das ist mehr als dreimal so viel wie in jedem Jahr zwischen 2000 und 2016. Dabei zieht insbesondere RISC-V Investitionen an: Dank dieser Open-Source-Befehlssatzarchitektur für das Chipdesign haben auch kleinere Gerätehersteller die Möglichkeit, kostengünstig Hardware zu bauen. Laut Deloitte Global wird sich der Markt für RISC-V-Prozessorkerne im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 verdoppeln.
„Wir sollten uns nicht auf ein einziges Land oder ein bestimmtes Unternehmen verlassen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“
Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb und Digitales
Lieferketten resilienter gestalten
Doch nicht nur die Halbleiterindustrie reagiert. Durch den Halbleitermangel ist auch die Abhängigkeit bei der Versorgung mit Halbleiterprodukten von wenigen Ländern und Herstellern deutlich zu Tage getreten und hat sowohl Kunden als auch die Politik wachgerüttelt. Seitdem stellt sich allen die Frage, wie die Lieferketten robuster gestaltet werden können. Das neue Schlagwort Resilienz beschreibt in diesem Kontext die Widerstandskraft einer Lieferkette, sich externen Störfaktoren zu widersetzen beziehungsweise sich neu ausrichten zu können.
Mehr Chips im eigenen Land produzieren
Um diese Widerstandskraft zu erhöhen, nehmen Regierungen rund um die Welt viel Geld in die Hand. Ihr Fokus liegt dabei insbesondere darauf, mehr Chips im eigenen Land zu produzieren. „Die weltweiten Lieferengpässe zeigen: Deutschland und Europa haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, unseren Bedarf an Mikroelektronik selbst zu decken, und die Produktion wieder stärker nach Deutschland und Europa holen. Dafür werden wir Fördermittel in Milliardenhöhe in die Hand nehmen“, so der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister
Robert Habeck. „Wir wollen die Chip-Produktion in Deutschland und Europa stärken und unabhängiger von internationalen Lieferketten werden.“ Die Europäische Kommission hat dafür den European Chips Act auf den Weg gebracht: Er soll 43 Milliarden Euro in Form von öffentlichen und privaten Investitionen mobilisieren, um künftige Unterbrechungen der Lieferketten zu verhindern. Die Ziele beschreibt der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton so: „Die Sicherung der Versorgung mit den modernsten Chips ist zu einer wirtschaftlichen und geopolitischen Priorität geworden. Unsere Ziele sind ehrgeizig, denn bis 2030 wollen wir unseren Marktanteil auf 20 Prozent verdoppeln und in Europa die ausgereiftesten und energieeffizientesten Halbleiter herstellen.“ Auch in den USA passierte unlängst ein vergleichbares Gesetz das Repräsentantenhaus: Es sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 52 Milliarden US-Dollar zur Stärkung der heimischen Halbleiterfertigung und -forschung vor.
Beschaffung optimieren
Doch auch die „Verbraucher“ von Halbleitern selbst ergreifen zunehmend Maßnahmen, um von ihrer Seite aus die Lieferketten resilienter zu gestalten. Allen voran die Automobilindustrie, die besonders unter dem Halbleiterengpass gelitten hat. Die Unternehmensberatung Roland Berger empfiehlt Unternehmen aus der Automobilindustrie und anderen Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind, die Krise aktiv zu adressieren. Hierzu zählen technische Maßnahmen wie ein schnellerer Wechsel auf einen zentralisierten bzw. zonalen Aufbau der Fahrzeugelektrik und -elektronik, um so die Anzahl der benötigten Chips zu reduzieren. „Langfristig müssen OEMs und Zulieferer ihre Design-Philosophie anpassen, um mit den dynamischen Kapazitätsveränderungen in der Halbleiterindustrie Schritt zu halten. Die Bewältigung der Krise erfordert strategische Maßnahmen“, betont aber Thomas Kirschstein, Principal bei Roland Berger. Dabei stellen direkte langfristige Lieferverträge mit Halbleiterunternehmen, die wechselseitige Kapazitätszusagen und Abnahmeverpflichtungen über mehrere Jahre enthalten, einen wichtigen Hebel dar. „Die Lieferketten für automobile Halbleiter sind komplex“, sagt Gaurav Gupta, Research Vice President bei Gartner. „In den meisten Fällen sind die Chip-Hersteller traditionell Tier-3- oder Tier-4-Zulieferer der Automobilhersteller, was bedeutet, dass es in der Regel eine Weile dauert, bis sie sich an die Veränderungen der Nachfrage auf dem Automobilmarkt anpassen. Dieser Mangel an Transparenz in der Lieferkette hat den Wunsch der Automobil-OEMs nach mehr Kontrolle über ihre Halbleiterlieferungen verstärkt.“ So haben zum Beispiel Ford und BMW bereits direkt mit Globalfoundries Vereinbarungen zur Belieferung mit Chips getroffen. „Wir vertiefen unsere Partnerschaft mit den Lieferanten an wichtigen Stellen im Lieferantennetzwerk und synchronisieren unsere Kapazitätsplanung direkt mit den Halbleiterherstellern und -entwicklern. Das erhöht die Planungssicherheit und Transparenz über die benötigten Mengen für alle Beteiligten und sichert unseren Bedarf langfristig ab“, so Dr. Andreas Wendt, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Einkauf und Lieferantennetzwerk.