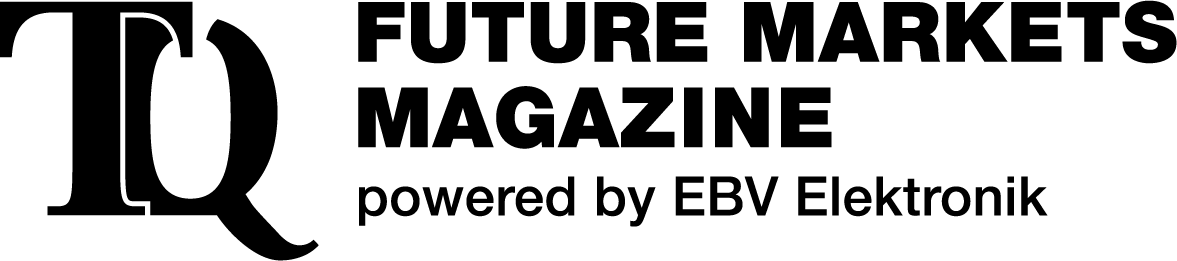Mit verschiedenen Ansätzen der Datenauswertung sollen Maschinen intelligent werden. Im Fokus steht dabei nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern immer mehr auch eine Flexibilität, wie sie das menschliche Gehirn bietet. Künstliche neuronale Netze spielen dabei eine große Rolle.
Künstliche Intelligenz ist nicht gleich Künstliche Intelligenz – denn es existieren verschiedene Ansätze, wie die Systeme ihr Wissen abbilden: Unterschieden wird vor allem zwischen den beiden methodischen Ansätzen der neuronalen Netze und der symbolverarbeitenden Künstlichen Intelligenz.
Wissen wird durch Symbole repräsentiert
Klassische KI beschäftigt sich vor allem damit, eine Aufgabe logisch zu analysieren und zu planen. Diese symbolische, auch regelbasierte KI ist die ursprüngliche, bereits in den 1950er Jahren entwickelte Herangehensweise. Dabei wird versucht, menschliche Intelligenz durch die Verarbeitung abstrakter Symbole und mit Hilfe formaler Logik nachzubilden. Das bedeutet, dass Fakten, Ereignisse oder Aktionen durch konkrete und eindeutige Symbole repräsentiert werden. Auf Basis dieser Symbole lassen sich dann mathematische Operationen definieren wie zum Beispiel das unter Programmierern bekannte Paradigma „wenn X, dann Y, sonst Z“. Das Wissen, also die Summe an Symbolen, ist in großen Datenbanken hinterlegt, mit denen sie ihre Inputs abgleichen. Diese Datenbanken müssen vorab von Menschen „gefüttert“ werden. Klassische Anwendungen der symbolischen KI sind zum Beispiel Textverarbeitung und Spracherkennung. Das wohl berühmteste Beispiel für symbolische KI ist DeepBlue: Der von IBM entwickelte Schachcomputer schlug 1997 mit Hilfe symbolischer KI den damaligen Schachweltmeister Garri Kasparow.
Die symbolische KI kann mit steigender Computer-Rechenleistung immer komplexere Probleme lösen. Allerdings arbeitet sie nach festen Regeln – soll sich eine Maschine außerhalb eines eng eingegrenzten Bereichs zurechtfinden, muss sie eine deutlich flexiblere KI haben, die auch mit Unsicherheiten und neuen Erfahrungen zurechtkommt.
Das Wissen über Neuronen selbstständig erweitern
Diese Flexibilität bieten künstliche neuronale Netze, die derzeit im Fokus der Forschung stehen. Mit ihnen wird die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachgebildet: Wie in der Natur bestehen künstliche neuronale Netze aus Knotenpunkten, die Neuronen oder auch Units genannt werden. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt oder von anderen Neuronen auf und leiten sie in modifizierter Form an andere Units oder an die Umwelt (als Ergebnis) weiter. Dabei wird zwischen drei verschiedenen Arten von Units unterschieden:
Input-Units nehmen von der Außenwelt verschiedene Informationen auf. Das können zum Beispiel Messdaten oder Bildinformationen sein. Die Auswertung dieser Daten, zum Beispiel dem Foto eines Tieres, erfolgt über mehrere Schichten von Hidden-Units. Am Ende des Prozesses geben Output-Units das Ergebnis an die Außenwelt: „Das Foto zeigt einen Hund.“ Die Auswertung erfolgt über die Kanten, über die die einzelnen Neuronen miteinander verbunden sind. Die Stärke der Verbindung zwischen zwei Neuronen wird durch ein Gewicht ausgedrückt. Je größer das Gewicht ist, desto größer ist der Einfluss einer Unit auf eine andere Unit. Das Wissen eines neuronalen Netzes ist also in seinen Gewichten gespeichert. Lernen erfolgt in der Regel über eine Veränderung des Gewichts, wie bzw. wann sich ein Gewicht verändert, ist in Lernregeln definiert. Bevor ein neuronales Netzwerk in der Praxis eingesetzt werden kann, muss es also zunächst mit diesen Lernregeln trainiert werden. Anschließend können neuronale Netze dann mit ihrem Lernalgorithmus selbstständig dazulernen und eigenständig wachsen – das macht neuronale Künstliche Intelligenzen zu sehr dynamischen, anpassungsfähigen Systemen, die auch Herausforderungen meistern, bei denen die symbolische KI versagt.
Kognitive Prozesse als Basis einer neuen KI
Eine weitere neue Form der Künstlichen Intelligenz haben Informatiker der Universität Tübingen entwickelt: Ihr Computerprogramm „Brain Control“ simuliert sowohl eine 2D-Welt als auch darin eigenständig handelnde, kooperierende und lernende virtuelle Figuren – oder Agenten. Die Simulation zielt darauf ab, moderne Theorien der Kognitionswissenschaft in ein Modell zu überführen und neue Varianten Künstlicher Intelligenz zu erforschen. Brain Control verzichtet bisher auf den Einsatz neuronaler Netze, folgt aber auch nicht dem klassischen KI-Paradigma. Die theoretische Kernidee hinter dem Programm entstammt einer kognitionspsychologischen Theorie, nach der kognitive Prozesse im Wesentlichen prognostizierbar agieren und auf sogenannten „Events“ basiert sind. Solche Events, beispielsweise eine bestimmte Bewegung, wie das Greifen nach einem Stift, und die Verkettung von Events, wie das Zusammenpacken, wenn man Feierabend hat, bilden demnach den Grundstock der Kognition, mittels dem zielorientiert Interaktionen und Interaktionsketten mit der Welt ausgewählt und kontrolliert werden. Diese Hypothese wird von Brain Control gespiegelt: Die Figuren planen und entscheiden, indem sie Events und ihre Verkettung simulieren und damit relativ komplexe Handlungsfolgen ausführen können. So können die virtuellen Figuren sogar kooperativ handeln. Zuerst bringt eine Figur eine andere auf eine Plattform, damit diese dort den Weg freimachen kann, woraufhin beide vorankommen. Die Modellierung kognitiver Systeme wie in Brain Control ist allerdings noch immer ein ambitioniertes Vorhaben, soll aber langfristig zu besserer Künstlicher Intelligenz führen.