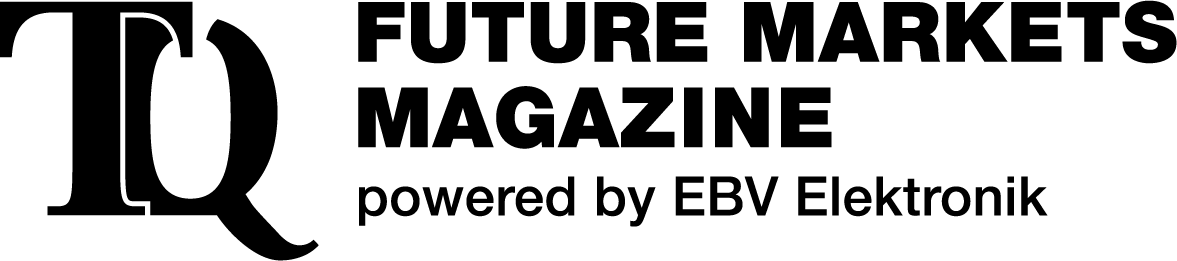Im Gespräch mit Prof. Dr. Gesche Joost, Internet-Botschafterin der deutschen Bundesregierung
Vermitteln ist ihre Mission – als Professorin für Design-Forschung an der Universität der Künste in Berlin baut Gesche Joost Brücken zwischen technologischen Innovationen und realen Anforderungen der Menschen in ihrem Alltag. Das von ihr geleitete Design Research Lab sieht sie als Vermittlungsstelle zwischen Mensch und Maschine. Wie kann man innovative Technik in den menschlichen Alltag integrieren? Wie mit ihr umgehen? Das sind Fragen, die die Kielerin, die bereits im Jahr 2006 zu den „100 Köpfen von morgen“ gewählt wurde, mit ihrem interdisziplinären Team lösen will. Ein typisches Projekt ist zum Beispiel eine Strickjacke mit integrierter Elektronik, die im Notfall automatisch Hilfe ruft. „Ohne das Internet geht in unserer Forschung gar nichts. Es ist die Grundlage für alles“, betont Gesche Joost. Sie ist damit mittendrin in der vernetzten Welt und weiß, wie man technologische Innovationen zum Menschen bringt. „Ich kann mir keine bessere digitale Botschafterin Deutschlands vorstellen“, sagte der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel. Und ernannte Prof. Dr. Gesche Joost in 2014 zum Digital Champion für Deutschland.
Ist die Digitalisierung der Politik so fremd, dass sie eine Internet-Botschafterin braucht?
Gesche Joost: Das hat sich massiv geändert. In der neuen Bundesregierung will jeder etwas zur Digitalisierung machen – was sehr gut ist und der Breite des Themas gerecht wird. Vorher wurde die Digitalisierung eher stiefmütterlich behandelt, heute beschäftigen sich immerhin drei Ministerien damit. Es gibt jetzt auch die erste digitale Agenda für Deutschland – auch wenn da noch Luft nach oben ist, was die Zukunftsfähigkeit und das Visionäre angeht.
Was sind Ihre Aufgaben als Digital Champion?
G.J.: Eingeführt wurde dieses Gremium von der damaligen EU-Kommissarin Neelie Kroes. Ihre Idee war es, dass jedes Mitgliedsland einen Internetbotschafter nach Brüssel schickt. Er beziehungsweise sie soll die digitale Agenda voranbringen und die Ideen des digitalen Binnenmarktes in den Mitgliedsstaaten stark machen. Meine Aufgabe ist also tatsächlich die einer Botschafterin, einer Vermittlerin zwischen Europa und Deutschland.
Sie sagten, in Deutschland beschäftigen sich drei Ministerien mit dem Thema – wäre es nicht effektiver, alle Initiativen unter einem Dach zu bündeln?
G.J.: Es wäre vorteilhaft gewesen, wenn man zunächst mal eine Digitalisierungsstrategie für Deutschland aus einem Guss entwickelt hätte. Aber die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema und muss in allen Ministerien mit Nachdruck behandelt werden: Was die Digitalisierung der Bildung angeht, den Fachkräftemangel, die digitale Strategie in der Wirtschaft und so weiter. Noch haben wir Abstimmungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Ressorts – deswegen fehlt die Vision aus einem Guss. Aber wenn erst einmal alle begriffen haben, wie wichtig dieses Thema ist, dann kommen wir auch mit der jetzigen Konstellation ganz gut voran.
Wie wichtig ist Industrie 4.0 im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Internet-Botschafterin?
G.J.: Für Deutschland ist das eines der Kernthemen. Viele sind der Meinung, dass wir die erste Runde im Spiel um die Digitalisierung international fast verschlafen haben und im Bereich der Internet-Wirtschaft bislang nicht gut abschneiden. Womit wir aber punkten können, ist der starke Mittelstand mit vielen Weltmarktführern. Wenn diese Unternehmen ihre Prozesse digital vernetzen und den Maschinen- und Anlagenbau digitalisieren, werden sie noch effizienter und kompetenter. Die entsprechenden Standards international zu definieren, ist ein wichtiges Zukunftsthema. Das ist nicht nur für Deutschland einer der zentralen Punkte, um im internationalen Wettbewerb mitspielen zu können, sondern auch für Europa.
Das heißt, die Resonanz auf die Initiative ist auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten groß?
G.J.: Ja. Dort wird es vielleicht „Smart Production“ oder „Smart Industry“ genannt, meint aber etwas Ähnliches. Deutschland hat europaweit allerdings eine Poleposition. Jetzt geht es darum, die verschiedenen Fäden schnell zusammenzuführen und auch international die Nase vorn zu behalten. Das heißt auch, in Europa gute Partner zu suchen und das Thema gemeinsam voranzutreiben.
Industrie 4.0 ist also kein nationales Thema, sondern ein europäisches?
G.J.: Ja, man muss auf jeden Fall europaweit denken und den europäischen digitalen Binnenmarkt sehen. Deutschland alleine wird keine große Hebelwirkung entfalten. Man muss sich noch stärker in internationalen Konsortien vernetzen – und wir müssen schneller sein in der Entwicklung von Standards und Best-Practice-Beispielen und eben auch im Export von entsprechenden Lösungen. Der asiatische und amerikanische Markt haben die Entwicklung nicht verschlafen. Wir müssen daher mehr Geschwindigkeit aufnehmen und nicht deutsch, sondern international denken.
Ist das Bewusstsein dafür in Europa denn da?
G.J.: Das Thema ist ganz gut angekommen, aber es fehlt noch die Durchschlagskraft. Nun gilt es, die hervorragenden Ergebnisse der Forschung und Entwicklung in gemeinsamen Industrie-Initiativen mit politischer Rückendeckung auf den internationalen Markt zu bringen.
Braucht es dazu nicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel im Bereich der Cybersecurity?
G.J.: Politische Rahmenbedingungen sind für den Schutz vor Industrie-Spionage wichtig, damit nicht durch Cyberangriffe wichtige Arbeitsergebnisse ausspioniert werden. IT-Sicherheit und die Nutzung von Verschlüsselungstechnologien für den Datenverkehr sind daher wichtige Faktoren.
Gleichzeitig geht es aus Nutzersicht darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Etablierung digitaler Technologien im Mittelstand hakt ja genau daran, dass kleinere Unternehmen zum Beispiel der Cloud nicht trauen. Wichtig ist es, bessere Angebote zu machen, zum Beispiel für sichere Cloud-Dienste, deren Server in Deutschland stehen. Cybersecurity könnte gleichzeitig ein Export-Schlager „Made in Germany“ werden, weil wir einfach ein hohes Sicherheits-Niveau haben. Da wäre eine industriepolitische Initiative wünschenswert – nicht mit kleinen Einzellösungen, sondern mit geballter Macht in Europa.
Beim „klassischen“ Internet dominieren die US-Unternehmen, die jetzt auch viel Geld in die Digitalisierung der industriellen Produktion stecken. Kann Deutschland oder Europa überhaupt gegen diese Wirtschaftsmacht bestehen?
G.J.: Wir haben insofern eine Chance, dass wir aus dem bestehenden Mittelstand einige Weltmarktführer und „Hidden Champions“ haben, mit denen wir auf internationalen Märkten konkurrenzfähig sind. Gegen die Finanzmacht der USA und China können wir kaum etwas ausrichten. Die Investitionen, die in Start-ups gehen, sind in den USA um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Das spricht noch einmal für ein europäisches Denken. Wichtig ist, dass man eine Konzentration der Mittel hat und nicht mit der Gießkanne hier und dort ein bisschen fördert. Also mehr klotzen statt kleckern.
Was kann die Politik tun, um die Chancen der Wirtschaft zu verbessern?
G.J.: Deutschland könnte sehr gut eine Leitposition einnehmen und Industrie 4.0 eben nicht deutsch denken, sondern europäisch. Deutschland könnte sich in Brüssel mehr zu dem Thema engagieren und auf europäische Netzwerklösungen bauen. Wichtig ist, dass Politik und Industrie Hand in Hand gehen. Wir brauchen eine Roadmap, um entsprechende Lösungen auf die Straße zu bringen. Mir fehlt hier noch die Geschwindigkeit im Prozess. Denn sonst werden uns fertige Lösungen aus Asien oder den USA den Weg vordiktieren.
Was bedeutet Industrie 4.0 für den Menschen, der in einer smarten Fabrik arbeitet? Wie wird sich die Arbeitswelt verändern?
G.J.: Es wird sich einiges ändern; und viele haben Angst davor. Das Horrorszenario der menschenleeren, Arbeitsplatz-vernichtenden Fabrik ist zu extrem gedacht. Dazu wird es nicht kommen. Allerdings werden einfache Tätigkeiten zunehmend wegfallen. Wir müssen daher massiv auf Weiterbildung von Fachkräften setzen. Der Umgang mit vernetzten Systemen wird eine Herausforderung sein.
Viele Studiengänge in Deutschland und Europa müssen so aufgestellt werden, dass sie die neuen Fachprofile der digitalen Arbeit abdecken können. Wir haben zwar gute Ingenieursstudiengänge. Aber es kommen vielfältige neue Profile dazu, die auch neue Kooperationen zwischen Industrie und Universitäten brauchen, um Menschen zielgerichtet auszubilden.
Sie haben ja sogar Programmierunterricht für Grundschüler gefordert …
G.J.: Ja, das ist sehr wichtig. Denn was die digitalen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern angeht, liegt Deutschland im europäischen Vergleich nur im hinteren Mittelfeld. Das können wir uns nicht leisten. In England wurde zum Beispiel im letzten Jahr Programmieren ins Curriculum aufgenommen. Dabei geht es um digitale Fähigkeiten insgesamt, nicht um Java oder C++. Medienumgang, Internet-Recherche, Privatsphäre, Datenarten – das sind Querschnittsthemen, die man nicht allein in einem Fach wie Informatik abdecken kann, sondern die man in die unterschiedlichen schulischen Fächer einweben muss. Im Moment ist es in Deutschland so, dass die Schule der einzige Hort des Analogen zu sein scheint. Das ist unhaltbar. Wenn wir diese Denkweise so weiter treiben, werden wir international abgehängt. Das heißt nicht, dass wir nur noch kleine „Nerds“ produzieren sollten. Man muss sich aber der Realität stellen und fragen, welche Kompetenzen vermittelt werden müssen, damit junge Menschen in einer vernetzten und digitalen Gesellschaft gut und angemessen leben können. Dazu braucht man eine bildende und reflektierende Begleitung. Das muss Schule heute leisten.
(Bildnachweis: Matthias Steffen)